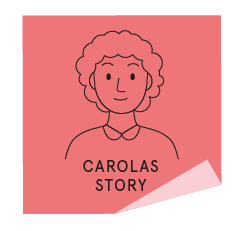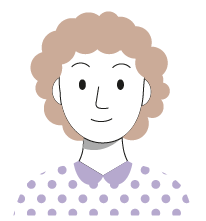Das Testament
Ein Testament hilft, dass im Todesfall Deine Wünsche umgesetzt werden und die Personen bedacht werden, die Du absichern oder begünstigen möchtest.
Was Du über die gesetzliche Erbfolge und ein Testament wissen solltest
Vorbemerkungen
Das Erbrecht ist ein eigenes und umfangreiches Rechtsgebiet, über das im Einzelfall nur ausgewiesene Expert:innen seriöse Auskünfte geben können. Hier sind Notar:innen sowie Fachanwält:innen für Erbrecht die richtigen Ansprechpartner:innen.
Die gesetzlichen Grundlagen kannst Du in Buch 5 des Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) finden. Darüberhinaus stellen zum Beispiel Bundes- und Landesministerien der Justiz, Verbraucherzentralen oder die Stiftung Warentest unabhängige Informationen für Verbraucher:innen zur Verfügung (⇒ Broschüren).
Das Thema Testament ist so komplex, dass wir hier nicht auf Details eingehen. Wir möchten hier vor allem die Personenkreise sensibilisieren, bei denen es in Folge der gesetzlichen Erbfolge zu unerwünschten Konsequenzen kommen kann. Für diese Personen ist die Erstellung eines Testamentes ein besonders wichtiges Thema und zu empfehlen.
Was ist die gesetzliche Erbfolge?
Das Erbrecht möchte sicherstellen, dass das Erbe vor allem innerhalb der Familie übergeht. In der heutigen Zeit sind die familären Lebensformen jedoch sehr vielfältig, somit passen die gesetzlichen Regelungen nicht zu allen Familienkonstellationen. Die gesetzliche Erbfolge kann daher zu unerwünschten Konsequenzen führen.
Die gesetzliche Erbfolge geht in der Grundlage von Ehepartner:innen aus. Neben diesen gehören deren Eltern und Abkömmlinge (Kinder, Enkel) zu den Erben 1. Ordnung. Je nach Entfernungsgrad der Verwandtschaft wird weiter unterschieden zwischen Erben 2. bis 4. Ordnung. Auch für eingetragene Lebenspartnerschaften gelten diese Regelungen.
Wer wann und zu welchen Anteilen erbt, ist von vielen Randbedingungen abhängig. Zum Beispiel, wer in der jeweiligen Ordnung noch am Leben oder schon gestorben ist, und ob Partner:innen in Zugewinngemeinschaft oder Gütertrennung gelebt haben.
Was kann ich mit einem Testament erreichen?
Mit Deinem Testament setzt Du Deine eigenen Schwerpunkte. Du kannst unabhängig von der gesetzlichen Erbfolge bestimmen, wer was und wieviel erben soll.
Indem Du dies selbst bestimmst, kannst Du unbeabsichtigte Benachteiligungen vermeiden. Du kannst auch sicherstellen, dass nicht Personen Zuwendungen erhalten, die Du nicht bedenken möchtest.
Was ist der sogenannte Pflichtteil?
Erben 1. Ordnung sollen nach dem Willen des Gesetzgebers nicht leer ausgehen, auch wenn Du sie testamentarisch nicht bedenken möchtest. Ihnen steht daher ein sogenannter Pflichtteil zu.
In aller Regel liegt dieser bei der Hälfte des regulären Erbteils (nach gesetzlicher Erbfolge). Wenn einem Kind regulär zum Beispiel 1/4 des Nachlasses zugestanden hätte, so läge sein Pflichtteil bei 1/8.
Welche Probleme können bei der Forderung des Pflichtteils entstehen?
Ganz unabhängig, ob die gesetzliche Erbfolge angewandt wird oder ein Testament vorliegt, kommt es oft dann zu Problemen, wenn ein Pflichtteil zusteht und eingefordert wird. Der Pflichtteil muss als Geldbetrag ausgezahlt werden. Wenn die dafür nötigen Mittel jedoch nicht zur Verfügung stehen, muss unter Umständen eine noch selbst genutzte Immobilie verkauft werden.
Was ist der Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis?
Der oder die Erben sind Deine Rechtsnachfolger. Sie sind für die Abwicklung Deines Nachlasses verantwortlich und zuständig.
Du solltest also zunächst Deine Erben benennen. Darüberhinaus kannst Du aber auch einzelnen Personen (oder Organisationen) sogenannte Vermächtnisse hinterlassen. Sie erhalten dann einen bestimmten und konkret benannten Teil des Vermögens, werden aber nicht zu Erben.
Wer sollte darüber nachdenken, ein Testament zu erstellen?
Zunächst solltest Du anhand Deiner aktuellen konkreten Situation überlegen, was in Deinen Nachlass fallen würde und wie hoch dieser ist. Anschließend machst Du Dir klar, wer im Fall Deines Todes nach der gesetzlichen Erbfolge diesen Nachlass erben würde. Wenn Du keine Einwände gegen diese Erbfolge hast, brauchst Du erst einmal nichts zu unternehmen.
Sobald sich jedoch Deine Lebenssituation ändert, Du eine Partnerschaft oder Ehe eingehst, (minderjährige) Kinder hast oder Dich möglicherweise wieder trennst oder neu bindest, solltest Du erneut über ein Testament und seine Ausgestaltung nachdenken.
Vor allem wird dies wichtig, wenn Deine Vermögenswerte mit der Zeit angewachsen sind. Dann spielen vielleicht auch steuerliche Überlegungen eine Rolle. Bei der Erbschaftssteuer gibt es unterschiedlich hohe Freibeträgen und Steuersätze für die Erben.
Bei den folgenden Fragen gehen wir auf unterschiedliche Personengruppen ein.
Unverheiratete Partner:innen – Welche Rolle spielt das?
Ob jemand verheiratet ist oder nicht, spielt im Erbrecht eine entscheidende Rolle. Nach der gesetzlichen Erbfolge geht der Nachlass zunächst nur an die Erben 1. Ordnung, also Kinder, Enkel ggf. Eltern des Erblassers. Der oder die unverheiratete Partner:in geht ohne Testament leer aus, auch wenn beide Partner:innen jahrelang zusammen gelebt und gemeinsames Vermögen haben.
Bei einer gemeinsamen Immobilie kann es also passieren, dass der Anteil des oder der Verstorbenen an seine oder ihre direkten Angehörigen fällt. Dabei gilt die Reihenfolge: zuerst Kinder, Eltern (falls Erblasser kinderlos), Geschwister (falls es weder Kinder noch Eltern gibt), Nichten/Neffen, ggf. Großeltern. Erst wenn überhaupt keine Verwandtschaft vorhanden ist, fällt der Nachlass an den Staat.
Sind Kinder vorhanden und sind diese minderjährig, so wird deren Erbe ggf. vom anderen sorgeberechtigten Elternteil oder dem eingesetzten Vormund verwaltet.
Mit einem Testament lassen sich Unverheiratete als Erben einsetzen, Pflichtteilsanspruch haben jedoch die Kinder und falls es keine Kinder gibt, auch die Eltern des oder der Verstorbenen.
Zu bedenken ist bei Unverheirateten, dass sie u.U. trotz Testament hohe Erbschaftssteuerbeträge zu erwarten haben. Für sie gilt nur ein Freibetrag von 20.000 € und für das darüber hinausgehende Erbe werden zwischen 30 und 50% Steuern fällig.
Warum sollten kinderlose Ehepaare ein Testament machen?
Kinderlose Ehepaare meinen oft, dass beim Versterben eines Partners, der oder die andere Partner:in Alleinerbe oder Alleinerbin wird. Doch bei gesetzlicher Erbfolge, d.h. ohne Testament gilt:
Falls die Eltern des oder der Verstorbenen noch leben, erben diese 1/4, der oder die überlebende Partner:in 3/4 des Nachlasses.
Leben die Eltern nicht mehr, so geht deren 1/4-Anteil auf die Geschwister des Erblassers über, ggf. auf desen Abkömmlinge (also Nichten und Neffen). Erst wenn es in dieser Abfolge niemanden (mehr) gibt und auch die Großeltern des Erblassers nicht mehr leben, erbt der oder die überlebende Partner:in alles.
Mit einem Testament kann vermieden werden, dass entfernte Verwandtschaft ggf. miterbt.
Wir haben Kinder, doch wir möchten uns zunächst gegenseitig absichern. Wie kann ich vorgehen?
Nach der gesetzlichen Erbfolge erbt der oder die überlebende Partner:in die Hälfte des Nachlasses, die Kinder die andere Hälfte. Machen die Kinder das Erbe geltend, so kann es dazu führen, dass Mutter oder Vater die nötigen Mittel zur Auszahlung nicht flüssig haben und die selbstgenutzte Immobilie verkaufen müssen.
Will man zunächst den oder die Partner:in absichern, können sich diese testamentarisch zunächst als Alleinerben und als Schlusserben die Kinder einsetzen. Diese könnten allerdings ihren Pflichtteil geltend machen. Auch für diesen Fall kann man mit einer Pflichtteilsstrafklausel Abhilfe schaffen: Fordert ein Kind seinen Pflichtteil beim Versterben des ersten Partners, so geht dieses beim Letztversterbenden leer aus und erbt nichts mehr.
Warum sollten Ehepaare mit minderjährigen Kindern ein Testament machen?
Das Absichern des Partners oder der Partnerin ist auch für Eltern mit minderjährigen Kindern zu empfehlen. Hier jedoch noch aus einem weiteren Grund. Nach gesetzlicher Erbfolge (bei Zugewinngemeinschaft) erben die minderjährigen Kinder (wie auch volljährige Kinder) die Hälfte des Nachlasses des verstorbenen Elternteils.
Enthält der Nachlass eine Immobilie so entsteht eine Erbengemeinschaft aus dem überlebenden Elternteil und den Kindern. Wenn im Hinblick auf die Immobilie Entscheidungen anstehen (Renovierung, Verkauf etc.) wird es kompliziert. Da minderjährige Kinder unter besonderem Schutz stehen, braucht man für Angelegenheiten der Erbengemeinschaft die Zustimmung des Familiengerichts. Damit sollen die Interessen der minderjährigen Kinder gesichert werden.
Mit einem Testament, in dem zunächst der oder die Partner:in als Alleinerbe bzw. Alleinerbin eingesetzt wird, bleibt der oder die Überlebende flexibel. Die Kinder erben später sowieso. Sie haben auch Anspruch auf ihren Pflichtteil, den sie bis zu ihrem 21. Lebensjahr einfordern können. Das Familiengericht hält sich bei diesem Vorgehen heraus, vor allem, wenn die minderjährigen Kinder ohnehin vom überlebenden Elternteil finanziell versorgt werden.
Warum sollte ich als Alleinerziehende:r mit minderjährigem Kind ein Testament machen?
Bist Du unverheiratet (also auch geschieden) und hast minderjährige Kinder, so erben diese im Fall Deines Todes Deinen gesamten Nachlass.
Der andere sorgeberechtigte Elternteil wird ohne Testament zum Vermögensverwalter Deiner Kinder. Das passiert automatisch, wenn Ihr gemeinsames Sorgerecht hattet.
Hattest Du alleiniges Sorgerecht, überträgt das Familiengericht dem anderen Elternteil das Sorgerecht einschließlich der Vermögensverwaltung, wenn es dem Wohl des Kindes nicht widerspricht.
Wenn Du sicherstellen möchtest, dass nicht Dein:e Ex-Partner:in, sondern eine Vertrauensperson von Dir das Vermögen Deiner Kinder bis zu deren Volljährigkeit verwaltet, kannst Du dies in Deinem Testament oder auch einer Sorgerechtsverfügung festlegen. Du bestimmst dann für die Vermögensverwaltung des Kindes eine Dir vertraute Person. Im Fall von Immobilienerbe wird das Familiengericht meist einen Ergänzungspfleger bestimmen, der die Interessen der Kinder wahren soll.
Wir leben als Patchwork-Familie. Warum sollten wir ein Testament machen?
Bei Patchwork-Familien kann es ohne Testament im Erbfall unbeabsichtigt zu unerwünschten Folgen und Benachteiligungen kommen. Besonders gilt das, wenn die Partner in der Patchwork-Familie verheiratet sind, jeweils eigene Kinder mitgebracht und zudem gemeinsame Kinder haben.
An einem Beispiel siehst Du die Folgen im Todesfall:
Jens und Petra bilden mit ihren drei minderjährigen Kindern eine neue Familie. Sie haben eine gemeinsame Tochter Lea. Jens bringt seine Tochter Marie mit und Petra ihren Sohn Sebastian.
Jens und Petra teilen sich jeweils das Sorgerecht für Marie und Sebastian mit ihren Ex-Partnern.
Angenommen, Jens kommt unerwartet zu Tode. Seine Frau Petra erbt die eine Hälfte des Nachlasses, seine leiblichen Töchter Marie und Lea jeweils 1/4. Das Erbe von Marie verwaltet seine Ex-Frau*. Petras Sohn erbt nichts. Verstirbt anschließend Petra, so fließt ihr Vermögen (einschließlich des Erbes von Jens) ausschließlich an ihre leiblichen Kinder Lea und Sebastian zu jeweils der Hälfte. An Marie geht nach gesetzlicher Erbfolge nichts mehr. Sie wäre benachteiligt.
*Falls Marie noch vor ihrer leiblichen Mutter versterben sollte, würde diese Maries Nachlass erhalten und damit auch einen Teil des Nachlasses ihres Ex-Mannes.
Mit einem Testament könnten Jens und Petra solche Benachteiligungen oder Verschiebungen des Vermögens vermeiden. Bei der Ausgestaltung sollten sie sich von Expert:innen beraten lassen.
Wir sind als Ehepaar unterschiedlicher Nationalität. Was gilt für uns?
Bei Partner:innen unterschiedlicher Nationalitäten kann es im Erbrecht kompliziert werden. Es muss geklärt werden, welches Landesrecht gilt: Das jeweilige Recht des Landes, aus dem die Partner:innen stammen bzw. des Landes, in dem sie überwiegend leben?
Innerhalb der EU gibt es die europäische Erbrechtsverordnung. (Die Länder Irland und Dänemark sind nicht Teil dieser Verordnung!)
Für den Fall, dass kein Testament vorliegt gilt: Im Erbfall wird das Recht des Landes angewendet, in dem der oder die Verstorbene zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Lebensmittelpunkt) hatte.
Paare unterschiedlicher Herkunftsländer sollten sich daher über die jeweiligen nationalen Erbrechtsregelungen sowie ggf. über erbschaftssteuerliche Auswirkungen informieren, z.B. bei Fachanwälten, die sich mit dem jeweiligen Landesrecht auskennen.
Welche formale Gestaltung muss ich unbedingt beachten?
Wird ein privatschriftliches Testament errichtet, muss es von Anfang bis Ende persönlich und von Hand geschrieben werde.
Um Verwechslungen zu vermeiden sollen alle Namen vollständig und Geburtsdaten angegeben werden. Anschließend folgen Ort und Datum sowie die eigenhändige Unterschrift.
Bei einem gemeinschaftlichen Testament kann ein Partner den Text verfassen, der andere Partner darunter den Zusatz setzen: „Dies ist auch mein letzter Wille.“, Ort und Datum notieren und unterschreiben.
Bei komplexen Vermögens- oder Familienverhältnissen empfiehlt sich der Gang zu Expert:innen. Ein notarielles Testament wird von einem Notar oder einer Notarin als Urkunde erstellt. Die Kosten richten sich nach einer Gebührentabelle in Abhängigkeit vom Vermögen.
Was gehört nicht ins Testament?
Bis zur Testamentseröffnung nach dem Tod können einige Wochen vergehen. Daher sollten im Testament keine Bestattungswünsche angegeben sein. Dazu kannst Du eine Bestattungsverfügung schreiben. Auch andere wichtige Informationen, die die Erben nach Deinem Tod benötigen, sollten direkt für sie oder eine eingeweihte Vertrauensperson zugänglich sein, zum Beispiel ein zentrales Passwort (Masterpasswort).
Hast Du eine Übersicht über wichtige Unterlagen und Informationen mit unserer Excel-Vorlage erstellt, erleichterst Du Deinen Nächsten die notwendigen Arbeiten und Recherchen erheblich.
Wo sollte das Testament aufbewahrt werden?
Im Todesfall muss das Testament schnellstmöglich dem Nachlassgericht zugeleitet werden. Erben sind verpflichtet, ein privat aufbewahrtes Testament unverzüglich dort abzugeben.
Du kannst Dein Testament in Deinem Dokumentenordner aufbewahren und vertraute Angehörige darüber informieren. Wenn Du Sorge hast, dass es in falsche Hände gerät, so kannst Du es beim Nachlassgericht (Amtsgericht Deines Wohnortes) hinterlegen.
Ein notarielles Testament wird dort ohnehin gemeldet und hinterlegt. Im Todesfall wird es dann sicher berücksichtigt.
Seit 2012 werden alle staatlich verwahrten Testamente zudem verpflichtend dem Zentralen Testamentsregister (ZTR) der Bundesnotarkammer gemeldet. Die Inhalte der Verfügungen werden nicht hinterlegt, nur der Verwahrort der Urkunde. Eigenhändig erstellte und beim Nachlassgericht hinterlegte Testamente werden verpflichtend vom Amtsgericht an das ZTR gemeldet. Ein Erklärfilm des ZTR erläutert das Vorgehen.
Und was ist mit der Erbschaftssteuer?
Erbschaftssteuer wird erst dann fällig, wenn das Erbe die persönlichen Freibeträge der Erben übersteigt. Bei Ehepartnern liegt dieser bei 500.000 €, bei Kindern jeweils bei 400.000 € pro Elternteil und bei Enkeln jeweils bei 200.000 €.
Unverheirateten und anderen Verwandten wie Geschwistern, Nichten oder Neffen steht nur ein Freibetrag von 20.000 € zu.
Fällt ein Erbe an die Eltern oder (Ur-)Großeltern (Voreltern), so steht diesen ein Freibetrag von 100.000 € zu. Bei Stief- oder Schwiegereltern liegt der Freibetrag bei 20.000 €.
Die Höhe der Steuer hängt wiederum von der Erbschaftssteuerklasse und Erbschaftssteuersatz ab. In die günstigste Steuerklasse fallen Ehepartner und Kinder. Je nach Höhe der zu versteuernden Erbschaft fallen hier zwischen 7% und 30% Steuern an. Unverheiratete fallen in Steuerklasse 3 und zahlen zwischen 30% und 50% Steuern.
Um Erbschaftssteuern gering zu halten oder zu vermeiden, kann das Erbe auf mehrere Erben verteilt werden oder es können bereits zu Lebzeiten Schenkungen vorgenommen werden. Für Schenkungen gelten die gleichen Freibeträge, sie können jedoch alle 10 Jahre erneut genutzt werden.
Fundierte Auskünfte und Beratung erhältst Du zum Beispiel bei Steuerberater:innen. Für eine erste Einschätzung findest Du im Internet verschiedene „Erbschaftssteuer-Rechner“.
Und wenn ich noch Fragen habe oder Hilfe benötige?
Hast Du weitere Fragen, weil Deine Situation kompliziert ist oder Du zusätzliche Unterstützung brauchst? Diese Stellen helfen weiter:
- ein Notariat (Notarsuche und weitere Informationen: https://www.notar.de)
- eine auf Familien- und Erbrecht spezialisierte Anwaltskanzlei (Suche über den Deutschen Anwaltverein (DAV) e.V., die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) oder die Rechtsanwaltskammern der Bundesländer)
Bei Fragen zur Erbschaftssteuer wendest Du Dich am besten an Steuerberater:innen.
Broschüren
Die genannten Broschüren und Formulare stellen eine Auswahl dar. Du kannst sie kostenfrei herunterladen. Sie enthalten wichtige Informationen.
Gedruckte Broschüren sind zum Teil auf Bestellung oder kostenpflichtig im Buchhandel erhältlich.
Testament und Erbfall / Erbschaftssteuer
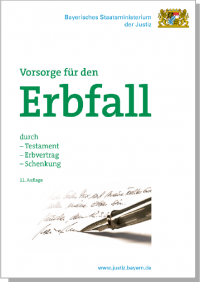
Vorsorge für den Erbfall
Hrsg. Bayer. Staatsministerium der Justiz,
11. Auflage, 2025,
Infos und Formulierungsbeispiele

Erben und Vererben
Hrsg. Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz, 2024
Infos und Formulierungsbeispiele

Die Erbschaft- und Schenkungssteuer
Hrsg. Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat,
13. Auflage, 2023,
Steuerinformationen, Freibeträge, Steuerklassen und Steuersätze
Themenhefte der Verbraucherzentrale NRW und der Stiftung Warentest (kostenpflichtig):

Richtig vererben und verschenken
Hrsg. Verbraucherzentrale NRW
20 €, Shop der Verbraucherzentrale NRW

Vererben und Erben
Hrsg. Stiftung Warentest
24,90 €, Shop der Stiftung Warentest (SWT)
und:
Schwerpunktthema Testament in:
Hrsg. Stiftung Warentest, Finanzen, 3/2025, S 14 ff.

Schritt für Schritt zum Testament
Ganz allgemein gilt: Ein Testament zu errichten erfordert gute Überlegung und in den meisten Fällen fachkundige Beratung, um Fehler bei der Auslegung zu vermeiden.
Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass die gesetzliche Erbfolge sehr häufig zu unbeabsichtigten Folgen führt (⇒ Infos).
Da sich die Lebenssituationen im Laufe der Zeit ändern, kann es nötig werden, das Testament immer wieder anzupassen. Anlässlich besonderer Lebensereignisse (z.B. Partnerschaft, Heirat, Geburt von Kindern, Erwerb von Immobilien, Trennung und Scheidung) lohnt es sich, darüber neu nachzudenken und ggf. zu handeln.
1. Individuelle Lage analysieren
- Analysiere Deine Ausgangssituation (alleinstehend, verheiratet, (minderjährige) Kinder, in Patchwork-Familie, getrennt, geschieden …).
- Stelle Deine Vermögenswerte zusammen (Konten, Depots, Wertgegenstände etc.).
2. Mit gesetzlicher Erbfolge abgleichen
- Überlege anhand von Informationen zur gesetzlichen Erbfolge, wer im Fall Deines Todes erben wird. (⇒ Infos)
- Prüfe, ob dies Deinen Wünschen entspricht.
3. Entscheidung treffen
- Hast Du festgestellt, dass die gesetzliche Erbfolge für Deine individuelle Lebenssituation nicht passt, so triff die Entscheidung, ein Testament zu erstellen.
4. Eigene Wünsche festhalten
- Notiere Dir, wen Du als Erben wofür einsetzen möchtest.
- Überlege, ob Du einzelnen Personen oder Organisationen ein Vermächtnis zukommen lassen möchtest.
- Mache Dir auch Gedanken über eine eventuell für die Erben anfallende Erbschaftssteuer.
- Falls nötig, wende Dich an Experten zum Erbrecht, an ein Notariat und/oder Deine:n Steuerberater:in.
5. Thema in der Familie besprechen
Das Testament ist Deine ganz persönliche Angelegenheit. Du kannst und solltest über Deinen Nachlass frei entscheiden.
Nicht selten kommt es jedoch nach dem Tod zu innerfamiliären Streitigkeiten, weil sich der eine oder die andere der Nachkommen ungerecht behandelt fühlt. Unbeabsichtigte Benachteiligungen solltest Du mit einer individuellen Testamentsgestaltung natürlich vermeiden. Erbstreitigkeiten sind sehr unerfreulich, oft langwierig, kostspielig und belastend für das Familiengefüge. Nicht selten brechen die eigenen Kinder untereinander den Kontakt ab.
Vielleicht hast Du sehr persönliche Gründe für Deine getroffenen Entscheidungen. Die Erben können insgesamt besser damit leben, wenn sie Deine Beweggründe verstehen oder Du sie im Idealfall sogar in die Diskussion darüber mit einbindest.
6. Verfügung handschriftlich verfassen und unterschreiben
- Wenn Du Dein Testament selbst verfasst, musst Du es vom ersten bis zum letzten Wort handschriftlich und leserlich schreiben.
- Kennzeichne es mit der Überschrift „Mein Testament“ oder „Mein letzter Wille“.
- Es muss klar zu erfassen sein, wer (genaue Vor- und Nachnamen, ggf. Geburtsdatum) zu welchen Anteilen erbt.
- Du kannst einzelnen Personen Vermächtnisse machen, sie werden dadurch nicht zu Erben.
- Zum Abschluss musst Du das Testament unterschreiben sowie Ort und Datum nennen.
- Du kannst nachträglich Ergänzungen vornehmen und Auflagen anordnen (Grabpflege, Übernahme von Haustieren). Diese musst Du erneut unter Angabe von Ort und Datum unterschreiben.
7. Aufbewahrungsort wählen
Stelle sicher, dass Dein Testament schnell gefunden wird:
- Füge es Deinem Notfall- oder Dokumentenordner bei, der zu Hause gut aufzufinden ist.
- Informiere Deine vertrauten Angehörigen darüber.
- Hinterlege das Testament ggf. beim Nachlassgericht (Amtsgericht Deines Wohnortes).
- Ein notarielles Testament wird immer beim Nachlassgericht hinterlegt.
8. Aktualisierungen vornehmen
- Prüfe in regelmäßigen Abständen, ob Dein Testament noch Deinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Spätestens, wenn sich Deine Lebenssituation gravierend verändert, solltest Du an eine Anpassung denken.
- Änderungen und Ergänzungen kannst Du handschriftlich unter den Text des ursprünglichen Textes anfügen und mit Ort und Datum neu unterschreiben. Achte darauf, dass sich keine widersprüchlichen Formulierungen ergeben.
- Ein gemeinschaftliches Testament können in der Regel nur beide Partner abändern.
- Wenn Du ein neues Testament schreibst, gib an, dass Du damit alle früheren Testamente widerrufst und vollständig aufhebst.
Gut zu wissen – Gültigkeit
Im Zentralen Testamentsregister (ZTR) der Bundesnotarkammer werden 2012 verpflichtend alle staatlich hinterlegten Testamente registriert. Dadurch wird sichergestellt, das letztwillige Verfügungen sicher gefunden werden.
Die Registrierungen werden entweder durch Notar:innen oder (bei eigenhändig erstellten und beim Nachlassgericht hinterlegten Testamenten) durch das Amtsgericht veranlasst.
Der Verfahrensprozess wird sehr anschaulich in einem Erklärfilm des ZTR dargestellt.
Privat verwahrte Testamente müssen im Todesfall umgehend beim Nachlassgericht abgegeben werden.